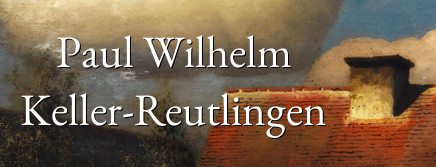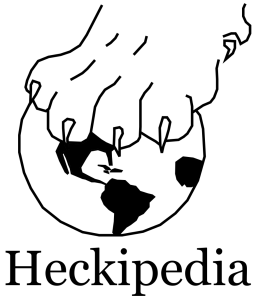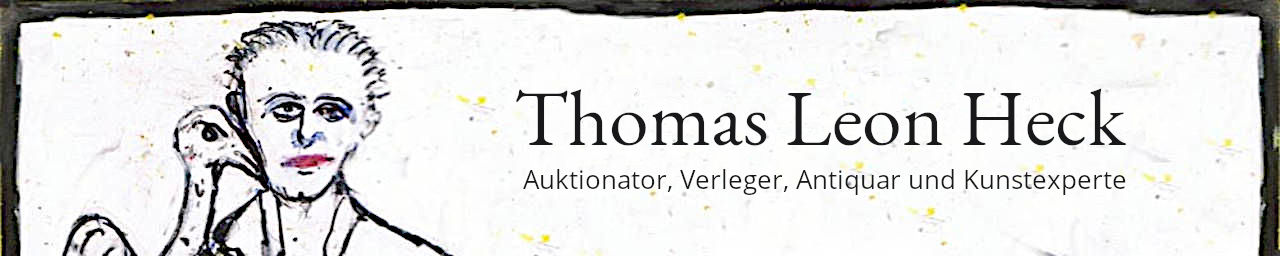
 zurück
Würdigung
zurück
Würdigung
VI Kunstgeschichtliche Würdigung
a) Vorbilder
Laut Kellers Bruder hat der Maler die Italiener studiert. Die "Kunstchronik" sah zumindest sein "Kornfeld" in diesem Zusammenhang, "auf dem der lichte Schimmer der Luft an den Goldton der Altvenezianer gemahnte" (N.F. V, 1894, S. 117).
Nach Auskunft seines Bruders hat Keller auch die alten Niederländer studiert, was plausibel erscheint, da er von ihnen die dramatische Lichtregie übernommen haben könnte.
Ich konnte nachweisen, dass sich im Nachlass von Kellers Vater ein Werk von "Achenbach" befand. Ob es sich hierbei um Oswald oder Andreas handelte, steht nicht fest. Andreas Achenbach aber hat eine Mühle gemalt, die von Keller sein könnte, so sehr ähneln sich darauf die graue Gewitterstimmung im Hintergrund und das sonnenbeschienene rote Dach.
Ein Stillleben Kellers mit Disteln und Schmetterlingen erinnert stark an Sibylla Merian.
Wahrscheinlich haben auch seine Lehrer auf Keller gewirkt, so der über 40 Jahre in München lehrende Otto Seitz, dessen Landschaften am feinsten sind, "von tiefem Stimmungsgehalt und starker Leuchtkraft der Farbe. Hier war er ganz original und bedeutend." (zit. n. VK 1911/12, Bd. 3, S. 319).
Was das 19. Jahrhundert betrifft, so hat man versucht, in Jean Auguste Dominique Ingres und Eugène Delacroix die beiden herausragenden Antipoden der Malerei dieser Epoche zu sehen. Ohne in dieser Debatte mitreden zu können, sehe ich Keller eindeutig als mit Ingres verwandt und nicht mit Delacroix. Keller ist wie Ingres akademisch, klassizistisch, idealistisch, form- und linienbetont, zeichnerisch, kurz apollinisch, um Nietzsches Begriff anzuwenden,
während Delacroix ganz anders als Keller malerisch ist, statt der Form den Ausdruck der Seele betont, spontan und modern ist, kurz dionysisch. Keller also ist ein Idyllen-Ingres.
Auch an Arnold Böcklin dürfte kaum ein Maler des späten 19. Jahrhunderts vorbeigekommen sein. Ähnlich Böcklin hat Keller durch Farbe poetisch denaturiert. Doch auf dessen pathetische Mythologeme verzichtet Keller völlig, sieht vielmehr das Dramatisch-Erhabene im ländlichen Alltag. Ich würde ihm gerne die Bezeichnung Bauern-Böcklin verpassen.
Auch von den Romantikern Schwind und Spitzweg könnte Keller gelernt haben, z.B. indem er deren Rückkehr ins Land der Kindheit übernahm.
Bei seiner Farbwahl in den Landschaften dürfte Keller von Hans Thoma beeinflusst sein.
b) Farbe
Ludwig Finckh beschreibt eindrucksvoll, wie der heute eher als konservativ geltende Keller damals avantgardistisch war: 1895 seien Kellers Bilder "in jeder Ausstellung", und der Maler gelte als "revolutionär", seine Bilder "galten als unerhört neu und frech. Der Kerl hatte grasgrüne Wiesen und blauen Himmel in der freien Natur zu malen gewagt - plein air! (...) Man erschrak fast vor seiner Kühnheit"!
Kellers Bruder Franz schreibt in seinem Nachruf: "Mit Vorliebe behandelte er die Dämmerung, weil die Farbtöne da am tiefsten und feinsten sind (...) Der künstlerische Gehalt seiner Arbeiten besteht in der Lösung von Farbproblemen, die er sich stellte, z. B. im Stillen Haus violette Schatten auf lichter Wand um späte Abendstunde (...) Ohne Effekthascherei, ohne Mache, ohne Übertreibung gibt diese Malerei die warmen Farben in P. W. Kellers Übersetzung wieder,
wie sie der Tag, wie sie Dämmerung und Nacht in feiner Stimmung und feinen Tönen uns zeigen."(a.a.O., S.18). Die violetten Schatten sind übrigens Gegenstand eines Briefwechsels zwischen Goethe und Lichtenberg. Lichtenberg hatte einen Schlüssel gegen eine weiße Wand gehalten "und fand den Schatten blaß lila". Er fragt Goethe: "Haben Ew. Hochwohlgeboren wohl auch schon die herrlichen lila Schatten gesehen?"
und stellt einen Bezug zu unserer Frage des Magischen Realismus bei Keller her, denn: "Es herrschte in dieser Kammer (...) ein sonderbares, ungewisses, magisches Licht." (Georg Christoph Lichtenberg, Aphorismen, Berlin o.J., S. 213).
Kellers Farben änderten sich fortwährend, vom ersten bis zum letzten Bild.
Für Dr. Horst Ludwig, einen führenden Kenner der Münchener Malerei, ist Keller "ein sehr eigenwilliger Maler, der den Umriß und die feste Form in seiner Bildwelt betonte. Gleichzeitig liebte er aber gesteigerte Beleuchtungseffekte und ein leuchtendes Kolorit mit starken Kontrasten" (S. ), Ludwig spricht von einem "bunt zu nennenden Kolorismus" (S. ). Einer der Gründe für Kellers z.T extreme Farbigkeit könnte darin liegen, dass sein Vater seit 1860 Bildchen aus Schmetterlingsflügeln zusammensetzte, deren Glanz bekanntermaßen spezielle Farbeffekte bewirkt (F. Keller 1970, S. 11).
c) Licht
Doch während Franz Keller seinen Bruder als Meister der Farbe bezeichnet, betont der bedeutende Kunsthistoriker Richard Muther (Prof. Dr. Muther, 1860 bis 1909, Konservator des Münchener Kupferstichkabinetts und Herausgeber der Monographienreihe "Die Kunst") schon 1893/94 in seinem Standardwerk über die Malerei des 19. Jahrhunderts, das durch neue Auffassungen und Urteile überraschte und von großer Wirkung war, Kellers Meisterschaft in der Behandlung des Lichts: "Er versteht den Reiz der Flachlandschaft mit ihren subtilen Farbeabstufungen
und der ganzen Lichtfülle des gewaltigen Himmelsgewölbes meisterhaft wiederzugeben"(Bd. 3, S. 442).
Und in einem Who is Who des geistigen Deutschland von 1898 heißt es von Keller, er zeige "neuerdings nicht minder feine Dämmerungs- und Nachtstimmungen".
Auch der Ausstellungskatalog "Die Münchner Schule" sagt: "Seine stillen, idyllischen Landschaften zeichnen sich vielfach durch interessant gesteigerte Beleuchtungseffekte aus" (S.255). Zu diesen besonderen "Beleuchtungseffekten" finde ich bei Theodor Lessing ein hochinteressantes Zitat:"Im Jahre 1882 flog durch vulkanische Eruption die Südseeinsel Krakatao in die Luft, wobei viele hunderttausend Menschen von der Flutwelle getötet wurden. Eine Riesenwolke feinen Staubes blieb in der Luft, umkreiste mehrmals die Erde und brachte die tiefen, farbigen Dämmerungserscheinungen hervor,
die von jener Zeit bis Mitte der neunziger Jahre in der ganzen Welt sichtbar waren. Es ist uns heute klar geworden, daß die Farbenwolken des Krakatao in innigster Beziehung stehen zu den neuen Malerfarben, den bunten Werten, den Neobildern, den Nuancen dieser Jahre." (S. 80). Die magischen Beleuchtungseffekte besonders auf Kellers "Idyllen hinterm Haus" dürften gerade in diesen Jahren erstmals entstanden sein. Aufgrund seiner Beleuchtungseffekte würde ich Keller am liebsten einen Meister des Lichts nennen, sogar einen Magier des Lichts.
Das kalte, scheinbar realistische Schlaglicht Michelangelo Caravaggios, das den Ausdruck in dessen Gemälden in "Chiaroscuro" (d.h. Hell-Dunkel-) Manier steigert und dramatisiert, verspotteten seine Zeitgenossen als "Keller-Licht". Bei Keller-Reutlingen könnte man auch von "Keller-Licht" reden, und dies im Sinne der Kritiker Caravaggios, aber natürlich auch als Wortspiel um Kellers Nachnamen, gehört doch die Behandlung des Lichts zu seinen herausragenden Eigenheiten. Caravaggio könnte dabei durchaus zu den italienischen Vorbildern des Reutlingers gehört haben (s. oben, Kap. VI a).
Kellers Vorliebe für beleuchtete Fenster stammt womöglich von Jugenderinnerungen her. Als Keller sechs war, verfasste der Lehrer Carl Bames ein Gedicht über die Veränderungen in Reutlingen, besonders durch die kurz zuvor eingeführte Gasbeleuchtung. Die Wirkung, die diese Innovation auf den Herrn Oberpräzeptor hatte, könnte der auf den kindlichen Keller entsprechen. Bames schreibt:"Die Straßen alle und die Hallen beleuchtet magisch-hell mit Gas" (zit. nach Stelzer S. 46)! Die Epoche matten Kerzenlichtes war vorüber, vielleicht hat der junge Keller mit seinen faszinierten Eltern
bei Spaziergängen im Dunkeln durch Reutlingen diese Magie eingesogen und ein Leben lang in seinen Bildern reproduziert.
d) Magischer Realismus
Nach einer zutreffenden Definition geht es dem Naturalismus um die „äußere Richtigkeit, dem Realismus um die innere Wahrheit". Insofern kann man Keller als Naturalisten bezeichnen, selbst wenn eine der bekanntesten Ausformungen dieser Stilrichtung in Malerei und Literatur sehr sozialkritisch war, ein Zug, den man bei dem idyllischen Reutlinger nicht findet. Malerisch kam es jedoch gerade ihm auf „äußerste Richtigkeit" an.
Er ist aber auch ein Realist, da es ihm zweifellos um innere Wahrheiten geht, selbst wenn man sich auch hier zunächst fragt, was er gemeinsam haben könnte mit Künstlern des Expressionismus, die ja gerade eine innere Wahrheit ausdrücken (exprimere) wollten und deshalb auch als Realisten bezeichnet werden.
Wegen seiner fotografisch genauen Malweise in Verbindung mit diesen "inneren Wahrheiten" habe ich als erster, nicht jedoch als einziger, Keller einen Vorläufer des "Magischen Realismus" genannt. Der Frankfurter Kunstkritiker und Publizist Dieter Hoffmann meinte mir gegenüber spontan, Keller sei gar "als Wegbereiter der Neuen Sachlichkeit zu feiern"! Der Kenner neusachlicher Malerei und Verfasser des Werkverzeichnisses von Paul Kälberer, Dr. Ludwig Dietz, stimmt dem zu.
Was die magischen Aspekte dieser Malrichtung betrifft, kann ich ohne weiteres zustimmen, freue mich aber in jedem Fall, dass diese Kunstkenner Keller für ähnlich bedeutend halten wie ich.
Vielleicht wäre die Bezeichnung Mystischer Realismus noch geeigneter, Kellers Versuche um Eindringlichmachung des Alltäglichen zu beschreiben. Seit den Hexenverfolgungen des 16. Jahrhunderts war das Magische mehr und mehr aus der aufgeklärten Welt vertrieben worden. Keller spürt dessen verbleibende Reste auf in der Versunkenheit seiner Idyllen. Kellers magischer Realismus ist jedoch nicht der der neusachlichen Ausformung der 1920er Jahre, sondern noch vom 19. Jahrhundert geprägt.
Ähnlich wie Caspar David Friedrich malte Keller Symbole, die für etwas anderes stehen, er fertigte Meditationsbilder wie die von Jan Vermeer. In seinen Bildern schafft Keller "eine verdichtete Gegenwart" (Saint-Exupéry, S. 94).
e) Beziehungen zur Fotografie
Der Beziehungen Kellers zur Fotografie ist weiter nachzuspüren. Inzwischen kann nämlich bewiesen werden, dass Keller Fotos als Vorlage verwendet hat:
1. Bei dem Werk "Drei Mädchen in Betzinger Tracht" (Katalog Keller 1996, S. 58) kopierte er ein Foto des Tübinger Fotografen Paul Sinner in eine bayerische Landschaft. (Sinner lebte 1838-1925. Zu ihm s. Tübinger Blätter 29, 1938, S. 45-49. Der Betzinger Bauer David Dalm brachte sonntags Betzinger in ihrer Tracht zu Sinner ins Studio. Keller konnte 1880 dieses Foto noch ohne weiteres kopieren, da Fotos erst 1894 urheberrechtlich geschützt wurden.)
2. Das Stadtarchiv Fürstenfeldbruck besitzt nach eigener Auskunft ein Foto das Flößers, das genau der Kellerschen Auffassung diese Motivs entspricht, so dass man auch hier davon ausgehen muss, dass der Maler das Foto kopiert, sprich malerisch umgesetzt hat.
Die "Photo-Sicht" (Zoege von Manteuffel, S. 11), die Bilder wie ein Fotograf hauptsächlich durch Wahl des geeigneten Ausschnitts zu komponieren, ist bei diesem Maler besonders ausgeprägt. "Da diese Photo-Sicht bis heute und wohl noch länger unsere Sehweise bestimmt, ist es wohl erlaubt zu sagen, daß Keller-Reutlingen hier unbewußt einen sehr zukunftsträchtigen Ansatz gefunden hat." (a.a.O.)
Ich lasse es offen, ob Keller hier nicht etwa doch bewusst gearbeitet hat. Keller hat nämlich durchaus auch in seiner fotografisch anmutenden Sicht komponiert, etwa indem er Bäume oder Häuser hinzufügte oder wegließ.
f) Impressionismus
Immer wieder wird Keller in Zusammenhang mit dem Impressionismus genannt (z.B. Wietek, S. 47, Haack 1925, S. 189. Ludwig meint, mit den Impressionisten verbinde Keller die Spachteltechnik (S. )). Auch die Kunstzeitschrift "Cicerone" von 1920 schreibt in einem Nachruf auf Keller: "War dieser Künstler auch kein entscheidender Schrittmacher im Sinne des Impressionismus, so doch eine der sympathischsten Erscheinungen im Rahmen der Münchner Landschafterschule, deren Werken alle Merkmale des rein Historischen anhaften."
Kurz bevor Keller an die Münchener Akademie ging (1873), hatte 1869 in München die Internationale Kunstausstellung stattgefunden, wo die Malschule von Barbizon präsentiert wurde, die als Vorläufer des Impressionismus gilt. Keller hätte also von Anfang an unter dem Einfluss des Impressionsmus stehen können. Doch der bedeutende schwäbische Kunsthistoriker Werner Fleischhauer sagt in seinem Artikel über Keller in dem maßgeblichen Allgemeinen Lexikon der Bildenden Künstler (von Thieme und Becker, Bd. 20, S. 114):
"Trotz seines Interesses an atmosphärischen Erscheinungen bekannte er sich nicht entschieden zum Impressionismus." Man könnte noch deutlicher sagen, Keller habe wenig von einem Impressionisten. Aus einem 40-Punkte-Katalog typischer Impressionismusmerkmale passen auf Keller weniger als die Hälfte. Wenn man so allgemeine Kriterien wie "Farbe" abzieht, liegt die Übereinstimmung mit den Impressionisten bei nur etwa einem Drittel, die Unterschiede dagegen bei zwei Dritteln.
Egon Friedell sagt über den Impressionisten, er kenne nur ein Gesetz, das des Augenblicks. Nach dieser Definition ist Keller mit Sicherheit kein Impressionist, denn die meisten seiner Bilder wirken statisch. Um einen Vergleich aus der Fotowelt zu verwenden: Die Impressionisten benutzen eine denkbar kurze Blende, Keller eine möglichst lange. Seine Gestalten wirken erstarrt, die Kinder sind in stilles Spiel versunken, die Tiere weiden fast unbewegt. Die Stille springt den Betrachter fast an.
Wie anders hingegen das Großstadtleben in Parks, auf Boulevards und bei Flüssen auf impressionistischen Gemälden. Diese lösen die Formen ihrer Gegenstände durch Farbe auf, während Keller ausgesprochen zeichnerisch die Umrisse möglichst präzise wiedergibt. Kellers zeichnerisches, also konturierendes Malen isoliert die Dinge, während die malerische Sehweise der Impressionisten sie verbindet und so ihren Zusammenhang sichtbar macht. Diese exakte Raffinesse mag er von seinem Beruf des Xylographen beibehalten haben.
Der Holz-Stich ist ja viel exakter als der Holz-Schnitt, und es ist gar nicht vorstellbar, dass Keller je die relativ groben Holzschnitte gemacht hätte.
Im Nachruf der dem Verleger Hirth gehörenden Münchner Neuesten Nachrichten vom 12.1.1920, verfasst wohl von Wilhelm Hausenstein, hieß es daher bereits schon richtig: "Seine Malerei suchte im Zusammenhang einer zeitgenössischen Bewegung, aber auf unverkennbar persönliche Weise ein ruhiges stilhaftes Element, das zum Naturalismus und auch zum Impressionismus in Gegensatz stand." Und ferner: "Die Neigung zu intimen, mitunter melancholischen Versonnenheiten, die seinen Arbeiten die besondere Stimmung geben,
war der wesentlichste Beitrag seines dichterischen Naturells, das der Sympathie gewiß sein konnte, auch wo es in seiner Bedeutung nicht überschätzt war."
Auch Hans Geller meinte 1951 zu Recht: "Er liebte stimmungsvolle Beleuchtungen und gab seinen Bildern lebhafte Farben. Er ging aber nicht zu dem in seiner Zeit sich entwickelnden Impressionismus über, sondern blieb in seinen Werken der Zeichnung und sorgfältigen malerischen Durchführung treu." (Zit. nach r.m.-m.)
Keller schätzte - darin klassisch wie Winckelmann - die Kontur, die die Impressionisten gerade auflösten.
g) Themen
Den epochalen Wechsel von biedermeierlicher Ländlichkeit um 1840 zur industrialisierten Verstädterung um 1900 drückt Ferdinand Franzel in seinem Gedicht "Wechsel der Zeiten" aus. Darin heißt es:
"Einst:
Vor den Häusern, grün beranket,
Blumengärten; und am Abend,
Wenn vom nahen Kirchturm summend
Feierabendglocken klangen,
kam der Hausherr in die Laube,
Setzt in Brand sein Tabakspfeifchen,
Nahm das jüngste seiner Kinder
Auf das Knie und neckte lächelnd
Dann den kleinen Strampelpeter.
Auf der wohl gepflegten Straße
Zogen singend Wanderburschen,
Grüße tauschend mit den Schönen,
Die am Brunnen Wasser schöpften
Oder zwischen Blumen aus den
Kleinen Erkersfenstern lugten.
Jetzt:
Vier Stock hohe Zinskasernen
Schlöte lärmender Fabriken,
Straßenbahnen, Radler, Droschken,
Schutzmannschaft an allen Ecken;
Wandersmann kommt aus der Kneipe,
Gröhlt ein Lied und eifrig packen
Ihn zwei wuchtge Schutzmannshände.
Möbelwagen knarren über
Holperiges Straßenpflaster,
Und die Schönen tauschen Grüße
Aus den eleganten Kutschen
Mit den Kavalieren, die in
Schnabeligen Lackstiefletten
Auf dem Asphaltsteige wandeln
Und sich näselnd Tschau" begrüßen." (in: Meggendorfer Blätter 1901, S. 126)
Dies ist auch Kellers Hauptthema. Er bearbeitet es, und darin ist er ein typischer Vertreter der Fin de siècle-Malerei, vor allem durch eine - eskapistische - Rückkehr aufs Land (s. besonders Punkt 3 dieses Kapitels: Idyll hinterm Haus).
In Kellers Werken sind z.T. magische Inhalte spürbar wie Geborgensein in der Kindheit im Gegensatz zur Bedrohung durch Umweltzerstörung. Das Paradigma Umweltschutz wurde zu Kellers Zeit entdeckt. So sind seit 1853, also ein Jahr vor der Geburt des Malers, "Rauchschäden" durch Schwefeldioxid bekannt.
Die heiteren Gefühle bei der Ankunft auf dem Lande (so der Titel einer Ausstellung des Württembergischen Landesmuseums von 1983), die um 1920 schon verloren gegeben waren, versuchte Keller noch zu bewahren. Dennoch kann man in seinen Bildern empfinden, dass die Idylle bedroht ist.
1. Landschaft
In Keller sah schon die zeitgenössische Kritik zu Recht in erster Linie den Landschaftsmaler, denn Porträts, Genreszenen und anderes stehen im Hintergrund. Der spätere Rottenburger Bischof Paul Keppler zum Beispiel machte sich 1895 "Gedanken über die moderne Malerei".
Zunächst stellte er eine "unheimliche" Masse und Mischung von Stilen fest. Malerei sei nicht Nachbildung, sondern Umformung, sie solle den Schein der Wirklichkeit erwecken. Die moderne Malerei entfalte ihr bestes Können in der Landschaftsmalerei, hier habe sie die Früheren überflügelt und erneuert.
Aber nicht "Schöngegendmalerei" sei ihr Programm, sondern das Unscheinbare, die "latente Poesie" z.B. "der Flachlandschaften; (...) der von Sonnenstrahlen durchirrten und durchflirrten Bäume, (...) des webenden Zwielichtes, der dunstigen Gewitteratmosphäre. (...) Die Parole heißt: (...) Stimmung ist überall".
Man könnte meinen, er habe Kellers Werk vor Augen, und in der Tat fährt Keppler fort: "Darin hat nun die moderne Malerei wirklich Großes, Bleibendes, Erfreuliches geleistet. Mit Genuß und mit dankbarer Anerkennung wirklicher Fortschritte betrachtet man (...) die Dachauer Bilder von Wilhelm Keller-Reutlingen".
Daneben werden lobend erwähnt Schönleber, L. Dill, Zügel u.a., entsetzt ist der Kritiker z.B. über Eckenfelder. (Über Kepplers Rang als Kunstkritiker s. Univ.Prof. Sauer, Freiburg, Bischof von Keppler und die Kunst, in: J. Baumgärtner (Hrsg.), (Festschrift) Dr. Paul Wilhelm von Keppler. Fünfundzwanzig Jahre Bischof. Fünfzig Jahre Priester, Stuttgart 1925, S. 55ff)
Besonders gerne malte Keller Flachlandschaften, wo er die Weite und das Himmelsgewölbe betonen konnte, und Abendlandschaften. Auf die besondere Wirkung des Abendlichts wurde bereits hingewiesen. Anton Springer behandelt die damals moderne Landschaftmalerei von 1870-1900, in der sich verschiedene Strömungen träfen, vor allem in der Behandlung des Lichts:
"Zugleich kehrten die Maler von der hellen Mittagssonne auch wieder zu der sanften Beleuchtung des Abends zurück, wie P.W. Keller-Reutlingen (geb. 1854), der die geheimnisvollen Stunden der Dämmerung" für seine Bilder wählte (S. 334).
Heilmeyer sagt bei einer Ausstellungsbesprechung über die verschiedenen Landschafter: "Eine weitere Gruppe möchte man die Lyriker unter den Landschaftsmalern nennen. Auch sie feiern zumeist den Abend, die unbestimmten weichen Töne und das Licht der Dämmerung, das um Busch und Wald geheimniss(!)volle Schatten webt,
über Wassern wie zarte Schleier schwebt und über Alles eine sanfte elegische Stimmung breitet" (S. 197). Dann erwähnt er Kellers Bild mit Fluss unter Weiden am Abend.
Eine Landschaft Kellers mit der Emmeringer Eiche wird von Velhagen Klasing hymnisch gepriesen: Sie "gehörte zu den schönsten Werken, mit denen die Münchener Sezession prunken konnte" (1905/06, S. 128).
2. Waldinneres
Es scheint, als würde Mark Twain 1878 ein Bild Kellers beschreiben, als er die Atmosphäre des Schwarzwaldes schildert: "Die Baumstämme sind stark und geradegewachsen, und an vielen Stellen ist der Boden meilenweit unter einem dichten Moospolster von leuchtendgrüner Farbe verborgen, dessen Oberfläche keine welken oder rissigen Stellen aufweist und dessen makellose Sauberkeit kein herabfallendes Ästchen oder Blatt befleckt.
Das satte Dämmerlicht einer Kathedrale durchdringt die Säulengänge; die vereinzelten Sonnenflecke, die hier auf einen Stamm und dort auf einen Ast treffen, treten deshalb stark hervor, und wenn sie auf das Moos treffen, so scheint das beinahe zu brennen. Aber die sonderbarste und zauberhafteste Wirkung bringt das zerstreute Licht der tiefstehenden Nachmittagssonne hervor; da vermag kein einzelner Strahl in die Tiefe zu dringen,
doch das diffuse Licht nimmt die Farbe von Moos und Laubwerk an und durchflutet den Wald wie ein schwacher, grüngetönter Dunst, das Bühnenfeuer des Feenreiches. Der Hauch des Geheimnisvollen und des Übernatürlichen, der zu allen Zeiten im Walde spukt, wird durch dieses unirdische Glühen noch verstärkt." (S. 153)
3. Idyll hinterm Haus
Thematisch sehe ich in Keller einen Antipoden zu dem französischen Maler Gustave Caillebotte (1848-1894), der etwa gleichzeitig in seinen Bildern die Vereinzelung des Menschen in der Großstadt von Paris festhielt, während Keller die Eingebundenheit des Individuums in eine ländlich-soziale Ordnung thematisiert.
Saint-Exupéry könnte ein Bild Kellers kommentieren, wenn er schreibt: "So habe ich lange den Sinn des Friedens bedacht. Er kommt nur durch die Kinder, die geboren werden, die geborgene Ernte, das endlich geordnete Haus. Er kommt von der Ewigkeit, in die die vollendeten Dinge eingehen. Friede der vollen Scheuern, der schlafenden Schafe,
des gefalteten Linnens, Friede, der von allem ausgeht, das Gottes Geschenk wurde, sobald es wohlgetan ist." (S. 51)
Wenn das 3. Programm am 24.1.2001 in "Baden-Württemberg aktuell" seine Fernsehnachricht über den ersten BSE-Fall im Kreis Reutlingen mit dem bewussten Blick auf Kellers "Idyll hinterm Haus" beginnt, das am Tagungsort des Krisenstabs im Landratsamt hängt, ist dies schon eine besondere Ironie der (Landwirtschafts-) Geschichte, von der der Maler keine Ahnung gehabt haben dürfte.
4. Hirten und Hirtinnen
"Wer noch so bescheiden einige Schafe unter dem nächtlichen Sternenhimmel hütet, wird merken, daß er mehr ist als ein Diener", sagt Saint-Exupéry (S. 123f). Diese religiöse Stimmung atmen viele von Kellers Werken. Das archetypische Bild des Hirten setzt er als ein Symbol ein, das auch noch der Existenzphilosoph Heidegger verwendet, wenn er vom Menschen als Hirt des Daseins redet.
5. Einsames Haus
Das eindringlichste Motiv Kellers ist das einsame Haus, hinter dessen Fenstern ein Licht brennt. Kellers Zeitgenosse, der Dichter Charles Baudelaire, hat das Geheimnisvolle dieses Sujets in dem Zyklus seiner Prosagedichte "Le Spleen de Paris" einzufangen versucht: "Wer von draußen durch ein offenes Fenster blickt, sieht niemals soviel wie einer, der ein geschlossenes Fenster betrachtet. Nichts ist so tief, so geheimnisvoll, so fruchtbar,
so licht und so finster zugleich wie ein Fenster, hinter dem eine Kerze brennt. Was man im Sonnenlicht sehen kann, ist immer weniger reizvoll als das, was hinter einer Scheibe vorgeht. In diesem düsteren oder strahlenden Loch lebt das Leben, träumt das Leben, leidet das Leben." (in: Sämtliche Werke, Frankfurt/Main 1992, Bd. 8, S. 257.)
Oft sieht man auf Kellers Gemälden auch mehrere Häuser, die sich zwischen schneebedeckten Hügeln ducken wie Vögel in ihrem schützenden Nest. "Die ganze Erde war übersponnen von Lichtgrüßen, jedes Haus zündete seinen Stern an vor der unendlichen Nacht, gleichwie man das Feuer eines Leuchtturms gegen das Meer wendet", sagte der Nachtpilot Saint-Exupéry (S. 135).
Keller drückte denselben Gedanken, aber vor dem Zeitalter des Fliegens anders formuliert, in seinen Bildern aus.
Über die möglicherweise epochale Wirkung dieses Motivs auf die Kunst der Moderne s. Kapitel VII f.
6. Abend- und Nachtbilder
Zu dieser Spezialität des Malers gehört u.a. das seit 1895 nachweisbare Motiv "Marktbreit am Main", über das Paul Schultze-Naumburg schreibt: "Keller-Reutlingen verzichtet nicht darauf, ein Farbenpoet zu sein. Da ist sein Blick auf Marktbreit. Feierliche Abendstimmung. (...) Keller-Reutlingen ist nicht wuchtig in seiner Malerei,
aber eine andächtige Naturversenkung stempelt ihn zum feinsinnigen Künstler. Aus seinem Abend spricht ein inniges, deutsches Element, dessen Zauber sich nicht leicht jemand entziehen kann."
Laut Oswald Schoch endete ziemlich genau um 1895, als eben Kellers Marktbreit-Motiv zum erstenmal nachzuweisen ist, die Langholzflößerei in Deutschland, und da gerade auf seinen Marktbreit-Bildern fast immer Langholzflöße abgebildet sind, fragt sich, ob der Maler nicht auch hier einer aussterbenden Branche seine Reverenz erweist und so einmal mehr der guten alten Zeit huldigt,
deren liebenswerte Gepflogenheiten einer als fremd empfundenen modernen Technik weichen müssen.
Eine Variante des Motivs besitzt der spanische Nobelpreis-kandidat Javier Marias. (s. Datei Kellmarias)
7. Straßenbilder
Der vom Münchener Haus der Kunst 1998 herausgebene Katalog zur gleichnamigen Ausstellung "Die Nacht" schreibt: "Die Straße wurde in Deutschland erstmals um 1900 von Lesser Ury und Ludwig Munthe malerisch umgesetzt." Dies ist nicht richtig, da Keller schon 1882-87 Straßenszenen am Strand von Neapel fertigte. Es ist allerdings so, dass er hierbei nicht die großstadttypische Anonymität und Bewegung thematisiert,
sondern eine eher genrehafte Betrachtungsweise hat. Doch selbt wenn man von diesen Bildern absieht, bleibt seine "Schwanthalerstraße" in München, die er 1893 künstlerisch wiedergab, und mehrfach 1897. Hier kommen schon deutlich Aspekte städtischer Verbauung, Geschäftigkeit und Anonymität zum Vorschein. So bringt der Maler sich selbst ins Bild, indem er - zwar mit Spitzwegschem Humor, aber dennoch vielleicht resignativ angesichts urbaner Vermassung -
von sich nur seine pinselhaltende Hand darstellt.
h) Varianten
Keller hat dasselbe Motiv z. T. oft wiederholt und dabei z. T. in unterschiedlicher Qualität gemalt. Eine geringere Sorgfalt der Ausführung und die damit verbundene Zeitersparnis machten das Bild für den Käufer entsprechend billiger. Dieser Unterschied fiel auch schon der Zeitung "Brucker Land und Leut" (Jgg. 1993, 29.5.1993) auf, wo zwei fast identische "Gänseliesln hinterm Haus" verglichen werden.
Das Bild aus dem Besitz der Stadt Fürstenfeldbruck Bild "gehöre zu den schwächsten" und spreche "von einer gewissen malerischen Wurstigkeit", das andere sei "weitaus liebevoller gemalt".
Manchen Kunstkritikern passt es nicht ins Bild des Originalgenies, dass eigenhändige Kopien vorkommen. So beschwert sich auch Charles Baudelaire über die Wiederholungen des belgischen Malers Alfred Stevens (in: Sämtliche Werke, Frankfurt/Main 1992, Bd. 7, S. 352). Keller hat einige seiner selbsterfundenen Motive wegen großen Erfolgs so oft und so ähnlich gemalt, dass man zur Unterscheidung gründlich hinsehen muss,
ob zum Beispiel die Socken auf der Wäscheleine rechts oder links von Laken hängen.
VII Wirkung des Malers
a) In Reutlingen
Zu Paul Wilhelm trug jemand wohl nicht ohne Stolz später im Kirchenregister ein: "bekannter Landschaftsmaler". Und anlässlich seines 150. Geburtstags am 4.2 2004 wurde Keller vom Reutlinger General-Anzeiger gar als "Malerfürst" bezeichnet. Doch die Wirkung des Malers in dessen Geburtsstadt beschreibt der Dichter Ludwig Finckh (1876-1964), der ein entfernter Vetter Kellers ist, so:
"in Reutlingen anerkannt war er nie. Und darum kam er auch nur selten heim." Finckh wohnte seit 1888 in der Gartenstraße gegenüber den Kellers und berichtet immer wieder lediglich die eine Anekdote, dass Paul Willi bei Finckhs an Silvester einen Kanonenschlag auf dem Gartentor ablegte. An mehr erinnert er sich wohl nicht, der Kontakt zu dem 22 Jahre älteren Keller wird nicht sehr eng gewesen sein.
Dass Keller Schwaben verlassen hat, war nicht ungewöhnlich. So schreibt Friedrich Pecht: "Die talentvolleren Schwaben wenden (...) ihrer Residenz gewöhnlich den Rücken und wandern alle nach München aus, wo wir ihnen in langer Reihe unter den Besten begegnen." (Zit. nach Weltkunst 19/1995, S. 2522). Seit Ende der 1860er Jahre war nicht mehr Düsseldorf, sondern München die erste Stadt in der Kunst (s. Bierbaum S. 6).
In Otto Fischers Standardwerk "Die schwäbische Malerei des 19. Jahrhunderts" fehlt Keller daher, und dies, obwohl Fischer ebenfalls aus Reutlingen stammt und als Direktor der Staatsgalerie Stuttgart sich professionell mit schwäbischer Malerei beschäftigte. Und leider hält die Münchener Kunstszene Keller aufgrund seines Anhängsels "Reutlingen" noch heute irgendwie nicht für einen Anghörigen der Münchner Schule, sondern für einen Schwaben.
So ist er irgendwie zwischen die Stühle geraten.
b) In der Literatur
Schon 1887 fiel dem Rezensenten der "Kunstchronik" eine Sommerlandschaft Kellers "durch eine wunderbare Feinfühligkeit auf" (XXII, Sp. 549). Als Kellers Vater 1890 starb, stellt der Bruder des Malers fest: "Den Ruhm Willis durfte der Vater nicht mehr voll miterleben, aber eine Freude machte ihm auch dessen schon frühe Glanzleistung und Höherdringen" (F. Keller 1936, S. 112). Und bald darauf, 1893, findet Alfred G. Meyer in derselben Zeitschrift
bei der Betrachtung eines "Bayrischen Dörfchens bei Nacht" von Keller, "alle diese Bilder, die auf jedweder Eisenbahnfahrt vorüberfliegen, werden unter seinem Pinsel zu gemalten Gedichten und fesseln, je länger man sie betrachtet" (N.F. IV, S. 27). 1894 zählt dasselbe Blatt daher Keller bereits zu den "aufstrebenden jungen" Größen, "die wir gern eingehender betrachteten" (N.F.V, Sp. 363)
Und schließlich sieht das Blatt 1895 gar durch Keller und weitere bis heute anerkannte Größen des Kunstmarkts eine Salzburger Ausstellung aufgewertet: "Andere Namen, wie Keller-Reutlingen, Josef Willroider, Jos‚ Villegas (Rom), Robert Poetzelberger möchte ich hervorheben, um zu zeigen, welche trefflichen Resultate die Bemühungen des Salzburger Vereins-Komités vom Künstlerhause zu verzeichnen haben" (Sp. 504).
1921 wurde Keller in das Werk von Hermann Uhde-Bernays, Münchner Landschafter im neunzehnten Jahrhundert, München, S. 149, aufgenommen. Uhde-Bernays (geb. 1874) war freier Kunsthistoriker und Rezensent von Rang in München. In der populären, großbürgerlichen Zeitschrift VelhagenKlasings Monatshefte wurden schon zu Lebzeiten des Malers etwa ein Dutzend Werke von ihm wiedergegeben (s. meinen Abbildungs-Index für VelhagenKlasings Monatshefte von 1886-1953, Tübingen 1997).
Auch Keller konnte sich einer nationalistischen Vereinnahmung nicht entziehen, die sich schon 1909 klar abzeichnete, als Prof. Dr. Franz Bock, Kenner vor allem mittelalterlicher und sakraler Kunst, in einem Verriss eines "Hausbuchs deutscher Kunst" schrieb: "Es dürften ferner nicht fehlen: Boehle, Kolb, Dettmann, Zügel, Skarbina, Kaiser, Erler, L. v. Hofmann, Gerh. Janssen (...), Riemerschmid, Pankok, Weise, Slevogt, Reiniger, Feddersen, Franck, Hartmann, Keller-Reutlingen, Hübner, Zwintscher, Brandenburg.
(...) Alle diese Meister machen in ihren besten Werken die gegenwärtige Blüte der deutschen Kunst aus, und diese FÜLLE der Talente und Individualitäten ist ganz wesentlich charakteristisch für das deutsche Kunstleben." (in: Walhalla, Bd. 5, 1909, S. 208). Bock veröffentlichte 1925 in Verfolgung dieses Ansatzes sein Buch "Die nationaldeutsche Kunst". Ob er dadurch mitveranwtortlich für eine kurios anmutende, offenbar nazistische Bilduntertitelung ist, weiß ich nicht:
Unter der Reproduktion eines Gemäldes von Keller mit Schafen im Wald steht der Titel "Schafe in der Ostmark", dessen Erfinder hier offenbar mehr weiß als ich und womöglich der Künstler selbst...
Das untenstehende Literaturverzeichnis verweist auf weitere Aufnahme Kellers in damals zeitgenössische Literatur.
c) Reproduktionen
1. Reproduktionen der "Jugend"
1909 veröffentlichte der Verleger der "Jugend" etwa 3000 Reproduktionen von Kunstwerken, die von 1896 bis 1909 in diesem Blatt erschienen waren. Die 10 000 Exemplare des Katalogs waren nach nur fünf Monaten vergriffen, die Neuauflage enthielt 3400 Abbildungen. Die Ausgabe von 1920 enthält alleine 26 Werke Kellers. Von allen Repros verkaufte man bis 1908 200 000 000 (200 Millionen!), bis zu Kellers Tod 1920 geschätzte 400 000 000!
Im Anhang von 1920 zählt der Verleger Hirth Keller zu den "namhaftesten" Künstlern, da er wohl überproportional an diesem gigantischen Erfolg beteiligt war. Denn allein von Kellers Bildern dürften statistisch 3 Millionen verkauft worden sein, so dass etwa jede(r) dreißigste Deutsche einen Keller-Reutlingen im Besitz gehabt haben dürfte. Diese Kunstdrucke werden mir manchmal noch heute als Originale vorgelegt.
2. Postkarten der "Jugend"
In der "Jugend" von 1910, Nr. 20, S. 468b, findet sich der Hinweis des Verlags, er habe sich auch zur "Herausgabe einer Anzahl Serien Jugend-Postkarten entschlossen, die in hervorragendem Vierfarbendruck Ende Juni 1910 in den Handel kommen werden". Die Serie drei ist ganz Keller gewidmet. Die Motive waren alle schon zuvor in der Zeitschrift selbst erschienen,
1. Im Unterbräu (Dachau), 2. Am Waldbach, 3. Dorfstraße, 4. Die Amper, 5. Spätsommer, 6. Sonnengruß. Die Postkarten waren "wirkliche kleine Kunstwerke", die jeweils 10 Pfennige kosteten. Schon Ende Dezember 1910 erschienen nach dem "grossen Beifall" für die zehn ersten Serien noch 20 weitere (Jugend 1911, Nr. 8, S. 184a).
3. Weitere Postkarten
Viele von Kellers Werken wurden durch ungefähr 40 Postkartendrucke „äußerst populär, die z.T. auch aus anderen Verlagen als dem der Jugend stammen. In der für die Plakatkunst äußerst wichtigen Zeitschrift "Das Plakat" wurden im August 1920 auch künstlerische Postkarten (als eine Art von Miniplakat) besprochen. Keller schneidet dabei im Verhältnis zu anderen Künstlern sehr gut ab:
"Ausgezeichnet sind die Karten mit stimmungsvollen Landschaften aus Fürstenfeld-Bruck bei München von dem unlängst verstorbenen KELLER-REUTLINGEN", die J. Woderer in Bruck verlegt hatte.
Die Wirkung dieser Karten auf die Verbraucher scheint ambivalent gewesen zu sein. So schrieb 1909 ein Hans Schäfer an seinen "lieben Walter" auf einer Postkarte mit Keller-Motiv: "Ich weiß nicht, ob Du diese Art Karten machst; so stelle ich mir ungefähr das Dörfchen vor, in welchem Du (...) so hochinteressante Stunden verlebt hast." Und als PS: "Verschone mich, wenn irgend möglich, mit der besagten Karte."
4. Sozialistischer Realismus
Kellers Realismus gefiel selbst in der ehemaligen DDR so sehr, dass dort (1956!) die größte Reproduktion eines Keller-Motivs hergestellt wurde, ein 67x93 cm großer Lichtdruck "Abendsonne", von dem gar die Deutsche Bibliothek in Leipzig ein Exemplar aufbewahrt. Die Affinität zwischen Keller und der Malerei des sozialistischen Realismus wird auch durch einen anderen Umstand belegt:
1998 kam Kellers Porträt einer Schnitterin mit Sense (!) in den Handel, das man als Werk des "sozialistischen Frührealismus" bezeichnen könnte, in dem die Arbeit, wie bei Millet, quasi religiös verklärt wird.
Zu Reproduktionen verweise ich ferner besonders auf das Kapitel "Jugend".
5. Sammelteller
Nicht jeden werden Kellers z. T. an Spitzweg erinnernden Idyllen ansprechen, andererseits darf Kunst zum Glück noch immer gefallen, so dass "Schönheit" auch hier im Auge des Betrachters ist. An dieser Stelle kann ich mir einen Kommentar zur Gegenwartskunst nicht verkneifen. 1886 schrieb August Strindberg in seiner Autobiographie "Die Entwicklung einer Seele":
"Eines Tages hatte er sich über Kunst zu äussern. Da er den Kopf voll von Tocqueville und der Demokratisierung der Kunst hatte, sprach er ganz unvorsichtig aus, ein Farbendruck nach einem von Correggios Meisterwerken sei eher dreissig Kronen wert als das Original eines Schülers der Akademie. Die Folge war, dass er in einem (...) Witzblatt (...) als ein Esel dargestellt wurde, der nach der von einem Schüler der Akademie vertretenen Kunst trat." (10.A., München/Berlin 1917, S.121). Das nur am Rande.
Wie sehr Kellers Bilder noch immer ansprechen, zeigt die Wirkung eines seiner Idyllen, das in der WELTKUNST 10/1993, auf S. 1197 abgebildet wurde. Das idyllische Bild fiel bei dem weltgrößten Hersteller von Sammeltellern auf, der Firma Bradford, die sogleich eine Delegation sandte, um die Möglichkeiten zu untersuchen, mit diesem Motiv einen Sammelteller zu produzieren.
d) Private Sammlungen
Ludwig Finckh bekennt:"ich schwärmte heimlich von ihm", weshalb er auch - aber erst 1938 - ein Gemälde seines Vetters erwarb, ein Waldinterieur, das in sein Schlafzimmer kam. Dort fiel, wie er schreibt, sein letzter Blick am Abend und sein erster am Morgen darauf und erinnerte ihn "an die Ruhe und den Frieden meiner Kindheit" (Inv. 166). Aus seinem Nachlass kam das Bild 1996 in den Handel.
e) Öffentliche Sammlungen
Schon 1896 erwarb der württembergische Staat das "Abendläuten mit heimkehrenden Mädchen" auf der Internationalen Kunstausstellung in Stuttgart für das Königliche Museum der Bildenden Künste, die jetzige Staatsgalerie. In das Städelsche Institut in Frankfurt/M. gelangte kurz darauf, 1899, als Geschenk von Leopold Sonnemann die "Mühle in Bruck" von 1898.
Sonnemanns Keller-Reutlingen trug zwar die Nr. 1 des Inventars, wurde aber 1919 verkauft.
Sonnemann (1831-1909) gründete 1899 den Städelschen Museumsverein, dessen erster Ankauf Max Liebermanns "Freistunde im Amsterdamer Waisenhaus" war. Sonnemann war der Gründer der Frankfurter (Allgemeinen) Zeitung, ein Gegenspieler Bismarcks, den Friedrich Naumann als "die letzte Gestalt unseres öffentlichen Lebens" bezeichnete, "in der noch etwas von der alten demokratischen Tradition in unsere Tage hineinragte" (zit. n. Manfred Overesch, Leopold Sonnemann,
in: Heinz Dietrich Fischer (Hrsg.), Deutsche Presseverleger des 18. bis 20. Jahrhunderts, 1975, S. 564, zit. nach NDBA 1235, S. 276. Vgl. auch die Dissertation von Klaus Gerteis, Leopold Sonnemann - Ein Beitrag zur Geschichte des demokratischen Nationalgedankens in Deutschland, Frankfurt/M. 1968).
Kellers Bilder findet man noch in einigen weiteren bedeutenden öffentlichen Sammlungen: in der Neuen Pinakothek München, in der Kunsthalle Kiel ("Einsames Haus"), ferner in Leipzig. Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden besitzen drei Werke Kellers: 1. Eine "Abenddämmerung" erwarb sie 1897 direkt vom Künstler auf der Internationalen Kunstausstellung in Dresden (Kat.Nr. 296).
2. "Schafe in einer Waldlichtung" befinden sich in Schloss Pillnitz.
3. "Gänseliesl mit Wäsche hinterm Haus".
Nr. 2 und 3 wurden erst 1950 von der Staatlichen Kunstsammlung erworben, nachdem die Bilder 1945-48 den unbekannten Vorbesitzern im Zuge der Bodenreform durch Enteignung weggenommen worden waren. Nicht nur Bücher haben ihr Schicksal, auch Gemälde. 1962 nahm die Dresdener Gemäldegalerie Neuer Meister diese Werke in ihren Bestand auf. Diesem Umstand ist es zu verdanken, dass Keller-Reutlingen in der größten Kunstfotothek der Welt vertreten ist, dem Marburger Index (s. hierzu Thomas Leon Heck, Der Marburger Index, in: Weltkunst 7/1996, S. 817).
Ein Werk Kellers kam durch Stiftung des Fabrikanten Sattelmayer an die Stadt Bad Urach (Ölgemälde "Schwäbische Dorfstraße mit Gänseliesl").
Teilweise sind Kellers Gemälde nicht mehr in staatlichen Sammlungen, sei es wegen Kriegsverlusten (Staatsgalerie Stuttgart - das Bild "Abendläuten" soll 1944 als Leihgabe beim Evangelischen Oberkirchenrat einem Bombenangriff zum Opfer gefallen sein), sei es wegen Abhandenkommens (Städtische Galerie im Lenbachhaus München - das Bild "Frühling" wurde 1928 erworben und seit 1953 an ein städtisches Krankenhaus ausgeliehen. Erst 1993 wurde es als "abgängig" bemerkt.)
Die Schenkung Conrad Fischers an das Schlesische Museum der Bildenden Künste in Breslau (Aquarell von 1895: Marktbreit im Mondlicht) ist verschollen.
Die Stadt Reutlingen mit über 20 Werken und die Sparkasse Fürstenfeldbruck besitzen die umfangreichsten Sammlungen seiner Bilder, darunter leider jeweils aber auch etliche unechte. Ferner befindet sich ein Keller-Werk im Eigentum der Oberschwäbischen Elektrizitätswerke (als Dauerleihgabe im Landratsamt Reutlingen).
Eine halböffentliche Sammlung war die des ehemaligen Stuttgarter Cafés Schapmann in der Königstraße, wo nach Aussagen mehrerer alten Reutlinger mindestens ein Werk Kellers hing.
f) Wirkungen in der Gegenwart
1. Edward Hopper
Einer Sensation käme es gleich, wenn sich meine folgende These beweisen ließe: Möglicherweise hat Keller durch sein erst spät (1912) belegbares Motiv "Einsames Haus" (s. Abb.), von dem es verbreitete Reproduktionen gab, auf amerikanische Künstler wie Edward Hopper gewirkt, der einige Gemälde und Grafiken ganz ähnlicher Motive fertigte.
Eines davon hat Alfred Hitchcock nachweislich zu seinem Filmklassiker "Psycho" inspiriert, wo der gestörte Norman Bates mit seiner toten Mutter in einer einsamen Villa "haust". Dann wäre die Seh-Erfahrung der gesamten Gegenwart letzlich womöglich von einem Haus in der Reutlinger Gartenstraße 31 mitgeprägt, das 1856 der Verleger Mäcken im Stil einer toskanischen Villa erbauen ließ!
Der junge Keller könnte hiervon inspiriert worden sein. (Eine Abbildung dieses Hauses findet man bei Stelzer, S. 95. Auch S. 34 käme als Vorbild in Frage.) Hoppers deutscher Biograph, Dr. Ivo Kranzfelder, findet meine These jedenfalls nicht abwegig.
Aber auch mit weniger wäre schon viel erreicht, nämlich mit einer annähernd gleichen Anerkennung für beide Maler, Keller und Hopper. Wenn Hopper als der größte amerikanische Realist des 20. Jahrhunderts bezeichnet wird, gar als der hervorragendste Realist dieses Jahrhunderts überhaupt (Kranzfelder S. 10), wäre es nur gerecht, wenn Kellers Ruf auch über den eines bloßen Idyllenmalers hinauskäme.
Der amerikanische Maler Edward Hopper (1882-1967) hatte 1920 in New York seine erste Einzelausstellung, also im Todesjahr Kellers. In diesem Jahr schuf er auch die Radierung "American Landscape", die ein an Keller erinnerndes einsames Haus zeigt. Die amerikanische Millionärin Gertrude Vanderbilt schenkte ihr Exemplar dem Whitney Museum of American Art in New York. Nach mündlichen Informationen sollen die Vanderbilts auch ein Werk von Keller-Reutlingen besitzen.
Es ist möglich, dass Hopper Kellers Werke bei den Vanderbilts kennengelernt hat, möglicherweise aber schon 1899/1900 beim Besuch einer Illustatorenschule, da Keller ja auch als Illustrator für den Jugend-Verlag tätig war, oder 1907 bei Hoppers Reise nach Berlin. Jedenfalls sind die Parallelen zwischen Hopper und Keller auffallend: Beide waren Realisten, ihre Themen und Stile änderten sich im Lauf vieler Jahrzehnte nur wenig, beide sind Vertreter einer Gedankenmalerei,
der jeder sozialkritische Ansatz fehlt. Hopper soll ein Modell aus Karton gebaut haben, um die Effekte von Licht und Schatten der einfallenden Sonnenstrahlen zu studieren (Kranzfelder S. 6), und Kellers Werke zeichnen sich ja bekanntermaßen durch gesteigerte Beleuchtungseffekte aus. Beide sind also Maler der Beleuchtung. Aus den Werken beider Maler spricht eine Religiosität, die Keller lebenslang durchhält, die bei Hopper aber später einer profanen Realität weicht.
Insofern vollzieht sich im Schaffen Hoppers der Bruch zwischen der Malerei des 19. Jahrhunderts und der Moderne. Beide Maler beschäftigen sich mit dem Verhältnis von Natur und Zivilisation. Die Nähe beider Künstler zur Fotografie wurde festgestellt (Zoege von Manteuffel S. 11, wo Keller hierdurch ein sehr zukunftsträchtiger Ansatz bescheinigt wird, und Kranzfelder S. 10). Die von beiden dargestellten Situationen wirken oft wie unter einer Käseglocke.
Beide erleben ihre Umwelt magisch. Beide streben in perfektionistischer Technik genaueste Übertragung intimster Natureindrücke an, und dies in einer Haltung, die dem rein Dekorativen entgegentritt. Hopper fühlt, dass "weiterer Fortschritt bei der getreuen Abbildung nicht mehr möglich ist" (Kranzfelder S. 14), und sie war ja wohl schon bei Keller nicht mehr möglich. Hopper hofft, die Malerei der Zukunft werde in der Lage sein, "die Überraschung und die Zufälle der Natur wieder zu erfassen
und ihre Stimmungen intimer und mitfühlender zu studieren, zusammen mit neuerlichem Staunen und mit Bescheidenheit bei denen, die zu solch elementaren Haltungen noch fähig sind" (Kranzfelder S. 15), was ziemlich genau dem Programm Kellers entsprechen dürfte. Beide interessieren sich für "das weite Feld der Erfahrung und Empfindung" (Kranzfelder S. 15). Bestimmte Gegenstände werden deshalb vorgezogen, weil sie die besten Mittler für eine Synthese innerer Erfahrung sind.
"Große Kunst ist der „äußere Ausdruck eines inneren Lebens im Künstler, dieses innere Leben führt zu seiner persönlichen Weltsicht" (Hopper), ein Motto, das genausogut von Keller stammen könnte.
Auch die Pittura metafisica eines Giorgio de Chirico ähnelt manchmal Kellers "Einsamem Haus", so z.B. in Chiricos Gemälde "Geheimnis und Schwermut einer Straße" von 1914, das auch von einem unheimlichen Dialog zwischen Fassaden und Schatten beherrscht wird.
Ob bei Hopper oder de Chirico jeweils direkte Beeinflussung durch Keller vorliegt oder nicht, wird sich vielleicht nie nachweisen lassen.
Gut 70 Jahre nach Kellers Entdeckung des Motivs "Einsames Haus" hat der Fotorealist Jan Peter Tripp 1983 ein Gemälde eines Hauses gefertigt mit dem Titel:"Hinter der Fassade fängt das Leben erst an". Somit zeigt sich hier eine wahrhaft avantgardistische Programmatik bei Keller. Jedenfalls hat Keller aber hier eine epochemachende Sichtweise vorweggenommen, was seinen künstlerischen Rang auf alle Fälle belegen dürfte.
2. Franz Radziwill
Oft erinnern die Gemälde Franz Radziwills (1895-1983) an Keller, besonders durch ihre übersteigerten Beleuchtungen, wenngleich die Radziwills noch unheimlicher und dramatischer wirken. Aus den Bildern beider Maler spricht manchmal eine geradezu bleierne Ruhe. Was der Biograph Radziwills über dessen Werke sagt, könnte auch für Keller stehen, besonders der Punkt der durch Überdeutlichkeit gesteigerten mysteriösen Wirklichkeit, die ein Überwirkliches ahnen lässt:
"Wirklichkeit wird geschaut und interpretiert als Situation des Übergangs, als Dualismus von Diesseitigkeit und Jenseitigkeit, von Da-Sein und Vergänglichkeit, von angehaltener Zeit und dramatischem Ereignis. Das Wirkliche in Radziwills Bildern ist durch Überdeutlichkeit derart gesteigert, daß ein Überwirkliches dahinter ahnbar wird. Die Wirklichkeit gerät Radziwill zum Mysterium, zu einem unerschöpflichen Wunder für ihn unergründbarer Beziehungen und Gegensätze zwischen Mensch, Natur, Zivilisation, Universum und Gott.
Dieser Dualismus bestimmt auch die bildnerische Methode des Kontrastes, in den motivischen Konfrontationen (Technik - Mensch - Natur), im Nah und Fern, Groß und Klein der Bildgegenstände, im Dissonanten der bis zur Buntheit gehenden Farbigkeit und in der exakt gefügten, klar überschaubaren Komposition, die beunruhigende Motivverschachtelungen und gegenläufige Sehdistanzen und Perspektiven beinhaltet. Die kläubelnde Akribie im Detail, der scharfe Kontur und der anstrichhaft flächige Farbkontrast isoliert die Objekte in ihrem einsamen,
verrätselten Dasein" (R. März, zit. nach Auktionskatalog Hauswedell Nolte, Hamburg, Mai 2000, Nr. 1807). Michael Lassmann spricht - noch prägnanter - bei Radziwill von einem "Zwielicht der Entfremdung" (in: Antiquitätenzeitung 1, 2001, S. 38), das, so meine ich, bereits bei Keller zu dämmern beginnt.
g) Kopisten und Fälscher
Von dem fast gleichalterigen Geflügelmaler Alfred Schönian (geb. laut Thieme-Becker 1856 in Frankfurt/Oder, lebte in München, wo er 1936 starb) gibt es mindestens ein Bild, auf dem im Hintergrund eindeutig ein Keller-Motiv kopiert ist: die zwei typisch im rechten Winkel zueinander stehenden Häuser mitsamt Wäscheleine und Holzzaun.
Auch von dem Maler Willem Hoy gibt es mehrere Gemälde mit ähnlichen Motiven, auf Postkarten des DEGI-Verlags reproduziert, die ohne Zweifel direkt auf das beliebte Motiv Kellers "Idyll hinterm Haus" zurückgehen.
Zu der Fälschungsproblematik s. Kap. X.
VIII Bildbeschreibung
Um einige von Kellers Eigenarten zu illustrieren, wähle ich für eine gründlichere Beschreibung exemplarisch eines seiner Hauptmotive, ein von mir so benanntes "Idyll hinterm Haus" aus meinem Besitz. Ein fast identisches Werk hängt übrigens im kleinen Sitzungssaal des Landratsamts Reutlingen als Leihgabe der Oberschwäbischen Elektrizitätswerke.
Der Ort
Den Vordergrund bildet ein Gewässer, der Hintergrund besteht aus Bäumen und zwei Häusern mit Schornsteinen, die jeweils rauchen. Links hängt Wäsche. Fast in der Mitte sitzen vier Kinder mit einer stehenden Aufpasserin. Die älteste Sitzende trägt eine Dachauer Tracht. (Ein ähnlich gekleidetes Mädchen bei Reitmeier 1, S. 143.)
Es handelt sich also um einen Hof bei Dachau nahe München, das Gewässer könnte der Fluss Amper sein.
Die Zeit
Die Sonnenblumen, der Holunder und das Schilf blühen, es muss also Juli sein, der einzige Monat, in dem diese drei Pflanzen gleichzeitig blühen. Zu einer weniger warmen Jahreszeit würde auch nicht das Jüngste "nackert" auf dem Boden sitzen. Der Wasserkrug zur Rechten des ältesten sitzenden Mädchens weist auch auf die Periode des großen Durstes.
Die Schatten fallen schon sehr lang - es ist Spätnachmittag. Die Wolken im linken Teil des Himmels sind dunkel: So kündigt sich ein Abendgewitter an. Dabei geht ein leichter Westwind, wie die geneigten Baumspitzen außerhalb des Hofs zeigen.
Die Personen
Eine junge Frau in Arbeitsschürze steht neben vier Kindern im Alter von ungefähr 1 1/2, 3, 6 und 12 Jahren. Die zwei älteren Kinder sind Mädchen, wie die Haartracht klar zeigt, die zwei jüngeren dürften Knaben sein. Alle 5 Personen sind blond. (Etwa zur gleichen Zeit, als das Bild entstand, schrieb Nietzsche 1887 in seiner Genealogie der Moral über die "blonde Bestie" ...)
Die Handlung
Eine Magd oder erwachsene Schwester (Mitte Zwanzig - man beachte die fast mathematisch-lineare Altersstufung!) hütet in stilles Spiel versunkene Kinder, die zuvor den Leiterwagen für ihre Zwecke entfremdet haben.
Perspektive
Der Betrachter blickt auf die Szene herab, aus einem Abstand von gut 50 Metern, möglicherweise aus einem Fenster im ersten Stock eines diesseits des Flusses liegenden Hauses.
Bildaufteilung
Das Bild kann man in vier gleich große horizontale Abschnitte unterteilen: Der unterste geht etwa bis zum Wägelchen, dort dominiert das Element Wasser. Der zweite reicht bis zur Unterkante der Dächer (Element Erde), der dritte bis an den Oberrand der Schornsteine (Feuer!), und das obere Viertel wird vom Himmel und von der Luft beherrscht.
Die Fluchtlinien der Dächer lenken den Blick auf den Kinderwagen.
Interpretation
Die kleine Gruppe bemerkt nichts von dem Beobachter, der aus diesem irdischen Jenseits ausgeschlossen ist. Denn die kleine Szene aus der heilen Welt der Kindheit (Franz Keller spricht vom "Märchenland der Jugend", 1936, S. 112) spielt in einem geschützten Raum: Durch die gluckhennenartig um den Garten liegenden Häuser sowie die große Distanz des Betrachters entsteht der Eindruck starker Abgeschlossenheit,
wie in einem Burghof, der auch von Wassergraben und Mauern umfasst wird. Die Welt mit ihren Problemen ist draußen. Der Vorabendfrieden ist vollkommen. Die links aufgehängte Wäsche zeigt aber, dass hier keine reine Idylle herrscht. Das für Keller typische Wäschemotiv störte einen meiner Kunden, einen Handwerkermeister, so sehr, dass er ein ähnliches Bild Kellers deswegen nicht kaufen mochte, weil es ihn zu sehr an (Hand)Arbeit erinnerte.
(Ich verkaufte es später an einen Fabrikanten - Marx hätte seine Freude an diesem Detail ...) Auch der Rauch aus den Kaminen deutet auf Küchenarbeit. Bei den Häusern handelt es sich nicht um einen einzigen Bauernhof mit Wohnhaus und Scheune, sondern um zwei Nachbarhäuser mit je eigenem Kamin. Doch kein Zaun trennt die Nachbarn, vielmehr könnten die Kinder teils aus diesem, teils aus jenem Hause stammen.
Fast wichtiger als die Anwesenden sind die Abwesenden: Die Eltern, die auf fast allen derartigen Bildern Kellers fehlen, sind wohl noch bei der Feldarbeit. Man könnte auf die Idee kommen, dass es dieselben sind, die Jean Francois Millet beim Abendgebet auf dem Feld porträtiert hat.
IX Marktanalyse
Thomas Mann gibt in seiner 1903 erschienenen Novelle "Gladius Dei" anschaulich Einblicke ins damalige Münchener Kunstleben. Keller war dort schon zu Lebzeiten sehr erfolgreich. Auf mehreren Bildern fand ich Etiketten der Frankfurter Galerie Hermes, die jüdische Besitzer hatte und daher seit dem 3. Reich dort zumindest nicht mehr existiert. Wenn schon allein diese eine Galerie so viele Kellers verkauft hat, wie gut muss es daneben noch für den Maler gelaufen sein! Selbst am seinem kleinen Wohnort Bruck verkaufte er seine Bilder gut.
Bereits 1901 wurde er im Auktionskatalog von Lepke, Berlin, unter die "Modernen Meister" eingereiht. Dort kamen zwei Werke von ihm aus der Sammlung von Carl Müller und Fr. Gurlitt unter den Hammer (zit. nach Thieme-Becker). Und 1910 findet sich ein Werk von ihm auf der Auktion Hugo Helbing vom 24.11. in München, das so gelobt wird: "Brillant in Stimmung und Beleuchtung".
Sein Bruder Franz nannte ihn "verwöhnt von der Gunst des Schicksals und der Bewunderung der Menschen, frei von Sorgen um den Lebensunterhalt" (S. 19). Werke von ihm wurden schon vor seinem Tod an öffentliche Sammlungen verkauft (s. oben). Ob Keller bei allem Erfolg auch zu den "kaum fünf Collegen" in München gehörte, über die der Maler Eduard von Grützner am 22. 12. 1907 schrieb, dass nur sie "ihre Bilder gleich verkaufen", kann ich leider nicht sagen (s. 664. Katalog Stargardt, Berlin 1996, S. 8)
In den USA soll er besonders viele Bewunderer gehabt haben. Wie seine Marktpräsenz in den Jahren nach dem 2. Weltkrieg verlief, zeigt mein Weltkunst-Abbildungs-Index. Keller war um 1970 nicht sonderlich gefragt. Inzwischen gehört er jedoch auf dem deutschsprachigen Kunstmarkt zu den Klassikern, so dass 1983 das Zentralorgan des deutschen Kunsthandels meldete, Werke dieses Malers erzielten bereits bis 85 000 DM (Weltkunst 9/1983, S. 1231). Die Preise für Ölgemälde schwanken derzeit von circa 2000 € für Ölskizzen bis zu 25 000, so dass die Preisentwicklung der letzten Jahre als stabil bezeichnet werden kann.
Aquarelle liegen je nach Qualität und Verkaufsort zwischen 1000 und 5 000 €. Aufgrund von Analysen meiner über 90 000 Weltkunst-Daten kann ich jedoch sagen, dass vor allem drei Dinge die Marktpräsenz und damit die Wertentwicklung eines Oeuvres beeinflussen: der Tod des Künstlers, eine große Ausstellung sowie das Erscheinen des Werkverzeichnisses oder einer umfassenden Monographie. Zum Thema Ausstellung schreibt Ludwig Finckh 1925: "Es ist zu bedauern, dass noch niemals eine übersichtliche Ausstellung seiner Werke zustande kam, weder in Reutlingen noch in Stuttgart".
(Noch Jahrzehnte später beschwerte sich Finck brieflich an U. Knapp: "Es hat mich auch immer gequält, daß die Reutlinger sich so wenig um unseren Vetter Willi Keller kümmerten.") Doch es sei "noch in 30 Jahren Zeit, ihn auszugraben." Es wurden fast genau 30 Jahre, denn anlässlich des 9. Familientags der Keller aus Schwaben am 25.5.1958 soll die Stadt Reutlingen im Heimatmuseum eine kleine Ausstellung von Werken Kellers durchgeführt haben, wie die Reutlinger Nachrichten vom 31.5.1958 und das Schwäbische Tagblatt meldeten.
Die erste große Einzelausstellung Kellers fand im Dezember 1996 im Spendhaus Reutlingen statt. Ich selbst erarbeite gerade das Werkverzeichnis Kellers. Aufgrund dieser Aktivitäten können Besitzer von Werken Kellers mit einer preislichen Belebung rechnen.
Typisch für Keller wie auch sonst oft auf dem Kunstmarkt ist, dass Künstler dort am beliebtesten sind, wo sie gewirkt haben. Dies liegt an den spezifischen lokal gepflegten Traditionen der Museumspolitik (Ankäufe, Ausstellungen) sowie der Privatsammler. So gehörte es in Reutlingen bis heute zum guten Ton der Oberschicht, einen Keller-Reutlingen zu besitzen. Die meisten Werke Kellers, die ich in Reutlingen kenne, befinden sich noch immer in Fabrikantenfamilien.
Diesem "Heimvorteil" des Malers dürfte es zuzuschreiben sein, dass er, obwohl er mehr zur Münchener Kunst gerechnet wird als zur Stuttgarter, nach meinen Recherchen in einer englischen Datenbank mit circa 1,5 Mio. Auktionsverkäufen, in Stuttgart seit 1970 mehr Werke Kellers zugeschlagen wurden als in München, und dies, obwohl es in München vier- bis fünfmal mehr international bedeutende Auktionshäuser gibt als in Stuttgart. Die Sammler korrigieren so eine zu einseitige Betrachtung durch die Kunsthistoriker,
die Keller nicht als schwäbischen Maler sehen, sondern als Münchener.
Bereits mehrfach zierte ein Werk Kellers den Katalogumschlag international bedeutender Auktionshäuser.
Zusammenfassend lässt sich über den Markt für Werke Kellers sagen: Angebot und Nachfrage regeln den Preis. Außer den zerstörten Werken wirkt der Anteil von unveräußerlichem Museums- oder Familienbesitz preisbildend, denn aufgrund der relativen Seltenheit von Werken Kellers sind in jedem Jahr nur gut 4 Keller auf dem Kunstmarkt. Bei anhaltender oder gar gesteigerter Nachfrage dürften also auch die Preise anziehen.
Ich wage sogar die Prognose, dass Keller wieder einmal die sechsstellige Preiskategorie erreichen wird. Dies war schon 1923 geschehen, allerdings ist der inflationsbedingt hohe Zuschlag von 1923 über RM 280 000 bei Bangel in Frankfurt/M. nicht aussagekräftig genug. Anders ein Ergebnis von 1942. Damals kaufte ein Uracher Fabrikant bei einem Kunsthändler im Kurort Bad Kissingen ein Gemälde Kellers für 12 000 Reichsmark.
Für dieses Geld hätte man mehr als eine Wohnung bauen können (s. Statistisches Handbuch der Stadt Stuttgart 1900-1957, Stgt. 1959, S. 209). Da ein Arbeiter im Jahr 1942 durchschnittlich 1 Reichsmark pro Stunde verdiente, hätte er für dieses Bild 12 000 Stunden arbeiten müssen. Das wären heute, bei 38,5 Wochenarbeitsstunden, über 300 Wochen, also etwa 6 Jahre. Einen Stundenlohn 1994 im Schnitt von etwa DM 23 zugrundegelegt, ergäbe sich ein Kaufpreis von 276 000 DM für dieses eine Ölbild
(womit wir wieder bei den Kosten für eine schlichte Wohnung wären). Es soll nicht verschwiegen werden, dass die Umrechnung auf Basis der Eier- oder Milchpreise nicht so beeindruckend ausfällt, da die Löhne viel mehr gestiegen sind als diese Lebensmittel.
X Das Oeuvre des Malers
Ich schätze das Oeuvre des Malers wegen seiner minutiösen Malweise auf nur etwa 600 Ölbilder und vielleicht ebenso viele Aquarelle und Zeichnungen. Es dürfte in zwei Weltkriegen von seinem Werk gut die Hälfte vernichtet worden sein: In München, wo wahrscheinlich die meisten Liebhaber von Kellers Kunst lebten, blieben im 2. Weltkrieg infolge der 66 Luftangriffe nur 2,1% aller Häuser unbeschädigt, während 34,5% schwer oder total zerstört wurden!
(Siehe Helmut Koenig, München im Wiederaufbau, Ein Querschnitt durch den Wiederaufbau Münchens, München um 1953, S. 25 und 34f.)
Einige wenige Exlibris hat Keller geschaffen (s. von zur Westen). Andere Techniken (wie Holzschnitt oder Radierung) hat der Künstler m.W. nicht angewandt. Einmal hat er eine photographische Wiedergabe eines seiner Gemälde durch die Berliner Photographische Gesellschaft eigenhändig signiert und ihr somit einen gewissen Charakter von Originalgraphik gegeben, dies ist aber ein Ausnahmefall.
a) Unechte Werke
Schon wenige Monate nach Kellers Tod hat die Witwe mit der Verwertung des Nachlasses begonnen. Dabei ging sie professionell vor. Sie wusste, dass das Echtheitsproblem im Vordergrund stehen würde, und ließ daher einen Nachlassstempel herstellen, der auf vielen Werken des Nachlasses angebracht ist:
" P.W. Keller-Reutlingen
München
ausgewählter Nachlass.
Albertine Keller-Reutlingen." (Trotz dieser Maßnahme bleibt das Problem, dass fast jeder Künstler Werke anderer Maler besitzt, die bei solcher Gelegenheit versehentlich mitabgestempelt werden. Der Erwerber glaubt dann irrig, ein Original des verstorbenen Malers zu besitzen, dabei handelt es sich um ein Werk eines befreundeten oder verehrten Malerkollegen. Dies muss nicht einmal zum Schaden des Erwerbers sein: Mir selbst sind Fälle untergekommen, bei denen es sich in Wirklichkeit um Werke viel bedeutenderer Künstler handelte.
Auch für Keller hat ein Kenner dies in einem Fall schon gemutmaßt, letzte Klärungen in solchen - sehr seltenen - Fällen sind - besonders bei Skizzen, Atypischem oder Unfertigem - äußerst schwer.) Ferner bestätigte die Witwe auf Wunsch eigenhändig die Echtheit. So existiert eine Zeichnung mit Gänselieselmotiv von 1888, auf der die Witwe rückseitig am 16.4.1920 versichert, dass es sich um ein Original ihres Mannes handle.
Es ist mir kein Fall bekannt, wo man hieran zweifeln könnte.
Nun gibt es zwar Maler, von denen mehr Gemälde kursieren, als sie gemalt haben. Corot, sagt man, habe 3000 Bilder gemalt, wovon allein 6000 in Amerika seien. Bei Keller ist es aber trotz etlicher Fälschungen nicht so drastisch. Aber Erfolg zieht immer Trittbrettfahrer an. So auch bei Keller. Mir sind über ein Dutzend (also fast jedes zwanzigste!) unechter Werke Kellers bekannt, die fast alle auf Auktionen waren und meist auch einen Käufer fanden. Die Qualität ist jedoch stets mager bis lachhaft.
Ein Fall betrifft ein Nürnberger Auktionshaus, wo eine Stuttgarter Kunsthandlung 1994 ein mit "Keller-Reutlingen" signiertes Gemälde für zirka 9000 DM kaufte. Das Werk wurde einem meiner Kunden zum doppelten Preis angeboten, der es mir rechtzeitig zeigte. Bald ermittelte das Landeskriminalamt gegen Auktionator und Einliefererin, da deren Freund dem Käufer den Tip auf das Bild gegeben hatte. Der Auktionator war dennoch nicht bereit, das Bild zurückzunehmen, da es auch von einem anderen Keller aus Reutlingen stammen könne.
Nach den zahlreichen Reproduktionen konnten dilettierende Maler die gefälligen Motive kopieren. Die eine oder andere Kopie tauchte auch schon als "echt" wieder auf. Dahinter steckt nicht immer die Absicht zu betrügen, weshalb hier nicht von Fälschungen gesprochen werden kann. Es sind dies lediglich unechte Bilder.
b) Ins Werkverzeichnis aufgenommene Werke
Das Fälschungsproblem führte also zu dem Bedürfnis eines Werkverzeichnisses. Ich arbeite seit 1992 an einem Verzeichnis sämtlicher Werke Kellers, wobei ich natürlich hoffe, dass Ludwig Finckh zumindest hier recht behält: "Dann werden wieder ein paar Verleger an ihm reich". Doch im Ernst: Wer Werke Kellers erwerben will oder schon besitzt, sollte daran interessiert sein, die Echtheitsfrage zu klären.
Hierzu bin ich bereit. Als Bearbeiter des Werkverzeichnisses bin ich meinerseits aber auch auf Mithilfe durch Besitzer und andere angewiesen, die über Informationen verfügen. Dazu gehören alle auch noch so unscheinbaren Details, die sich puzzleähnlich bei mir vielleicht einmal zu einem Gesamtbild formen. Besonders persönliche Zeugnisse des Malers oder seiner Frau fehlen bisher weitgehend.
Wer kennt Verwandte Kellers? Wer besitzt Selbstzeugnisse wie Briefe u.a. von ihm?
Wer mir ein noch nicht erfasstes Werk Kellers zeigt, erhält eine Expertise. Wer auf diesen Service verzichtet, bekommt spätestens beim Verkauf seines Bildes Probleme. Denn angesichts der Fälschungen wird niemand viel Geld für ein ungesichertes Bild ausgeben wollen. Jeder wird sich fragen, weshalb ausgerechnet für dieses Bild keine Expertise vorliegt.
Das kommt zwar bei jedem Künstler vor, erschwert aber auch regelmäßig die Veräußerung.
Wer Angst vor Einbrechern oder Steuerfahndung hat, kann mir auch ein anonymes professionelles Foto zusenden. Daran lässt sich, in Ermangelung einer Möglichkeit zur Autopsie, in der Regel die Echtheit erkennen. Diese im Reutlinger General-Anzeiger vom 7.2. 1995 auf S. 13 zitierte Äußerung von mir wurde von einem neidischen Konkurrenten auf infame Weise angegriffen. Der Prozess landete beim Landgericht Tübingen.
XI Anekdoten vom Keller-Markt
Wie ein Ei de
ca 1 000 ansichtskarten an Friedrich Aichinger, Jahrgang 1930 und später Fachschulrat in einer Stuttgarter Sehbehindertenschule sowie gründungsmitglied der christian-wagner-gesllschaft, plakette 1912 des juweliers klein, stuttgart, gegr. 1862
porträt einer lesenden biedermeier-dame, dat. 1880, sign. "m. Autenrieth" (wohl der mannheimer maler)